KI als Klimarisiko: Energieverbrauch von Rechenzentren wird sich bis 2030 verzehnfachen
550 Milliarden Kilowattstunden im Jahr 2030 – so lautet die Prognose für den weltweiten Energieverbrauch durch KI. Doch auch der steigende Wasserverbrauch sowie das Abfallproblem müssten dringend geklärt werden. Experten warnen zudem vor den indirekten Folgen von KI.

Künstliche Intelligenz (KI) hat einerseits rasante Fortschritte im technologischen Bereich möglich gemacht. Andererseits birgt sie auch zweifellos Risiken für die Umwelt. Eine aktuelle Analyse des Öko-Instituts im Auftrag von Greenpeace Deutschland warnt nun eindringlich vor den Folgen der expandierenden KI-Nutzung.
Laut den Prognosen wird sich der Strombedarf reiner KI-Rechenzentren weltweit zwischen 2023 und 2030 mehr als verzehnfachen – von derzeit rund 50 Milliarden Kilowattstunden auf rund 550 Milliarden Kilowattstunden im Jahr 2030. Rechnet man herkömmliche Rechenzentren hinzu, steigt der Gesamtstromverbrauch für Datenverarbeitung auf etwa 1400 Milliarden Kilowattstunden.
Weitere Auswirkungen auf die Umwelt
Der Klimafußabdruck dieser Entwicklung ist enorm: Auch wenn man annimmt, dass sich die erneuerbaren Energien weiterhin ausweiten, werden die CO₂-Emissionen der Rechenzentren bis 2030 voraussichtlich von 212 auf 355 Millionen Tonnen jährlich ansteigen, so das Öko-Institut.
Neben der Klimabelastung drohen aber noch weitere Auswirkungen auf die Umwelt. Laut Bericht wird sich der Wasserverbrauch für die Kühlung der Systeme auf 664 Milliarden Liter vervierfachen. Und auch das Abfallaufkommen steigt deutlich: Bis zu fünf Millionen Tonnen zusätzlicher Elektroschrott könnten durch den Ausbau der digitalen Infrastruktur anfallen. Zudem werden große Mengen an Rohstoffen benötigt, darunter 920 Kilotonnen Stahl und rund 100 Kilotonnen sogenannter kritischer Materialien.
Nachhaltigkeit zunehmend fraglich
Gleichzeitig ist fraglich, ob der künftige Energiebedarf überhaupt nachhaltig gedeckt werden kann. Die Stromnetze geraten zunehmend an ihre Grenzen. Der Verzicht auf fossile Energieträger ist bislang nicht realistisch.
– Jens Gröger, Forschungskoordinator für nachhaltige digitale Infrastrukturen am Öko-Institut
Besorgniserregend sind auch die sogenannten indirekten Effekte von KI. Zwar liegt der Fokus meist auf den direkten Umweltwirkungen wie Stromverbrauch oder Emissionen, doch KI verändert auch wirtschaftliche Strukturen. Beispielsweise wird sie bereits eingesetzt, um die Erschließung fossiler Energiequellen effizienter zu gestalten oder industrielle Landwirtschaft zu intensivieren. Gleichzeitig befeuert KI den Konsum durch personalisierte Werbung oder Empfehlungen.
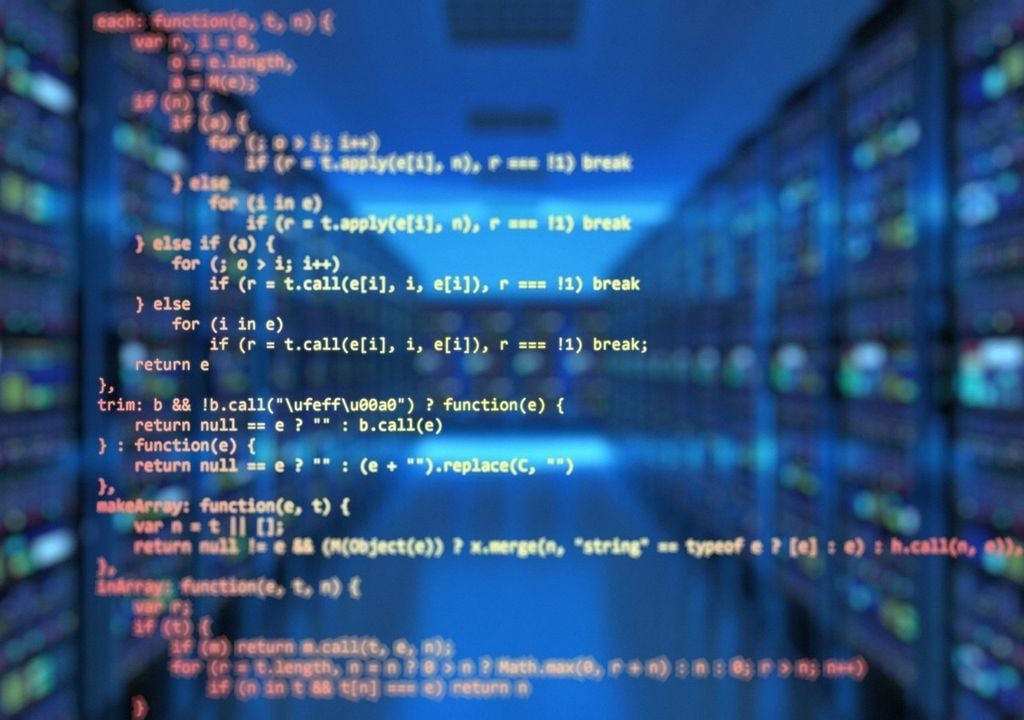
Fehlerhafte Trainingsdaten, ungeeignete Modelle oder falsche Annahmen im Betrieb von KI-Systemen können zusätzlich zu unbeabsichtigten Umweltbelastungen führen. Solche Effekte sind bislang kaum erfasst, obwohl sie in ihrer ökologischen Relevanz nicht zu unterschätzen sind.
Was muss geschehen?
Um alldem entgegenzusteuern, fordert die Studie des Öko-Instituts konkrete politische Maßnahmen. An erster Stelle steht die Einführung gesetzlicher Transparenzpflichten für Rechenzentren und KI-Dienstleister. Dazu zählt auch, dass Umweltdaten auf Anlagenebene verpflichtend veröffentlicht werden sollen oder dass Effizienzlabels für KI-Services entwickelt werden.
Auch Netzstrukturen sollten weiter angepasst werden. Dabei soll der Stromverbrauch von Rechenzentren künftig stärker an erneuerbare Energien gekoppelt werden, etwa durch zeitlich flexible Laststeuerung oder die Nutzung eigener Batteriespeicher.
Nicht zuletzt müssen KI-Systeme umfassend rechtlich neubewertet werden: Bevor neue Anwendungen auf den Markt gelangen, sollte eine Umweltfolgenabschätzung zur Pflicht werden, fordern die Forschenden. Nur so lasse sich verhindern, dass der technologische Fortschritt auf Kosten des Klimas erfolgt.
Die Befunde des Berichts machen deutlich, dass die Digitalisierung kein Selbstläufer in Richtung Nachhaltigkeit ist. Ohne politische Weichenstellungen und klare ökologische Leitlinien könnte sich die Klimakrise durch KI weiter beschleunigen.
Quellenhinweis:
Gröger, J., Behrens, F., Gailhofer, P., & Hilbert, I. (2025): Environmental Impacts of Artificial Intelligence. Evaluation of current trends and compilation of an overview study. Öko-Institut, Berlin, for Greenpeace e.V., Hamburg.








